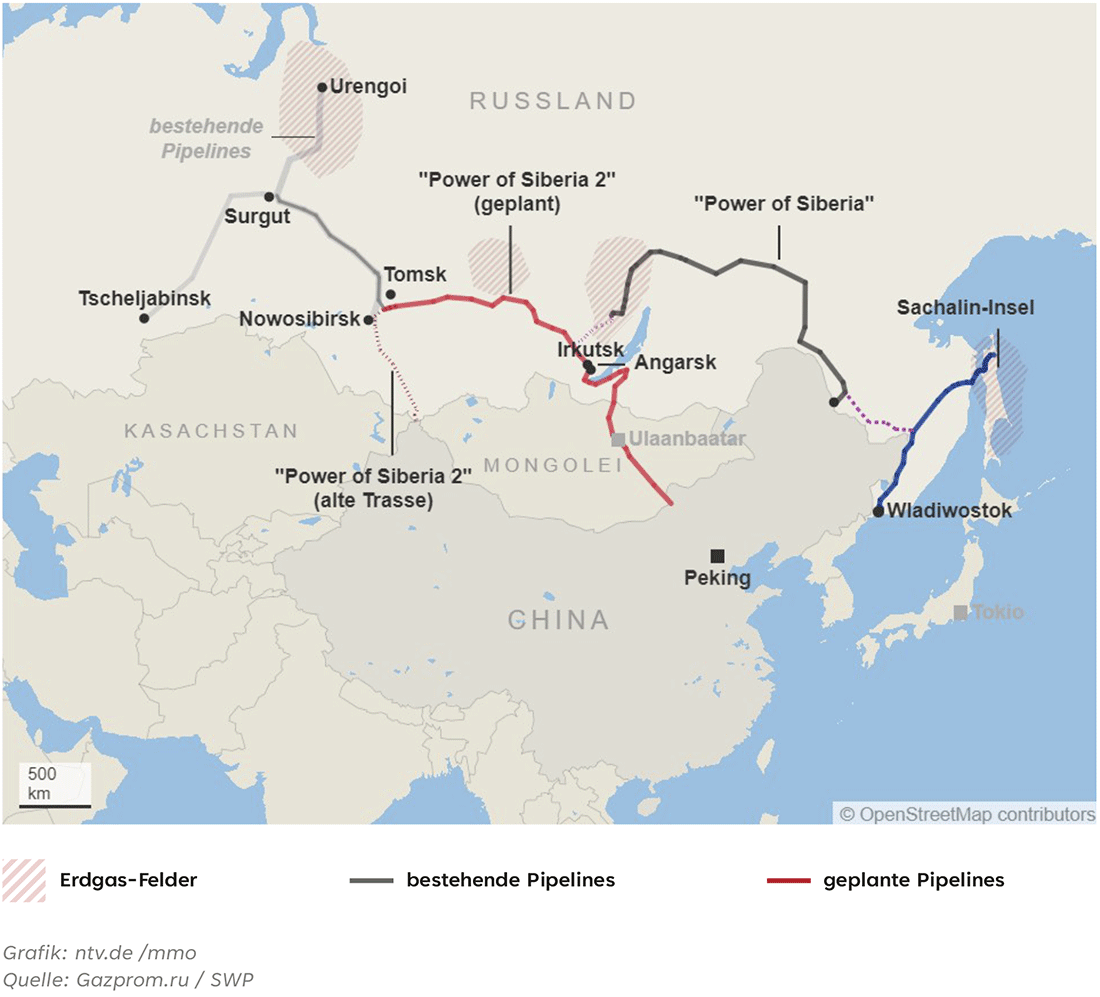Neues aus dem
fernen Osten
Wie ist China aktuell wirtschaftlich und politisch positioniert?
Auch wenn vordergründig etwas Ruhe in die internationalen Handelsbeziehungen eingekehrt ist, lieferte China in den vergangenen Monaten wieder viel Gesprächsstoff. Die andauernde Krise im heimischen Immobilienmarkt, die Neuwahlen in der Sonderverwaltungszone Hong Kong, die strikte Durchsetzung der Null-Covid-Politik, der Parteitag der Kommunistischen Partei mit der Wiederwahl Xi Jinpings und erste Anzeichen einer Neuausrichtung des Landes sind nur einige der vielbeachteten Themen.
Industrie und Politik in Europa und den USA beobachten aktuell besonders genau die Veränderungen im „Reich der Mitte“. Wir beleuchten, warum dies so ist, wie das Land aktuell wirtschaftlich und politisch positioniert ist und welche Entwicklungen von langfristiger Relevanz sind.
Motor der Weltwirtschaft
Der starke wirtschaftliche Aufschwung Chinas ist bislang ungebrochen (vgl. Abb. 1). In den Jahren 2013 bis 2017 war die chinesische Wirtschaft mit realen Wachstumsraten von durchschnittlich über 7% trotz ihrer Größe eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften weltweit. Aufgrund der günstigeren Preise für Waren und Dienstleistungen im Inland ist China kaufkraftbereinigt bereits seit 2014 die größte Volkswirtschaft der Welt, noch vor den USA1. Mit gutem Grund wird China daher als „Motor der Weltwirtschaft“ bezeichnet.
1Vgl. CIA Factbook (2022)
Bruttoinlandsprodukt (Nominal) der 10 größten Volkswirtschaften (in Mrd. USD)
Das Corona-Jahr 2020 verursachte einen Einbruch der jährlichen Wachstumsrate, das Wachstum konnte jedoch zum Teil im Jahr 2021 nachgeholt werden. 2022 zeigte eine deutliche Wachstumsdelle, in 2023 soll sich das Wachstum laut Prognosen wieder etwas beschleunigen (vgl. Abb. 2).
Jährliches Realwachstum ausgewählter Volkswirtschaften (in %)
Die offiziellen Daten und Prognosen zur Arbeitslosigkeit zeigen kaum Veränderungen. Für das Gesamtjahr 2022 werden 4,1% erwartet, für das Jahr 2023 4%. Bei der Inflation geht man von einem mäßigen Anstieg von 0,9% in 2021 auf 2,2% für das Gesamtjahr 2022 und für das Jahr 2023 von einem Wert von lediglich 2,3% aus. Die chinesische Wirtschaft scheint demnach in einer guten Verfassung zu sein, was aber hat dann den Wachstumseinbruch im vergangenen Jahr hervorgerufen? Wichtigster Faktor ist hierbei eindeutig der Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie.
Spätfolgen der Corona-Pandemie
Seit den ersten Infektionen in China trat die Führung für eine strikte Null-Covid-Politik ein und setzte diese rigoros und ohne Rücksicht auf individuelle Interessen um. Vermutlich schützte das die rund 1,4 Mrd. Einwohner vor einer unkontrollierten Durchseuchung. Die Befürchtungen waren groß, dass eine großflächige Ausbreitung insbesondere in den dicht besiedelten Millionen-Metropolen mit einer hohen Zahl an schweren Krankheitsverläufen verbunden gewesen wäre. China konnte zwar schnell eine größere Zahl eigener Impfstoffe entwickeln, im Vergleich zu westlichen Impfstoffen gelten diese jedoch als weniger zuverlässig, einen effizienten Impfschutz aufzubauen. Darüber hinaus war die medizinische Infrastruktur des Landes viel zu schwach, um einer drohenden Flut von Patienten gerecht zu werden, was die eilige Errichtung provisorischer Krankenhäuser anschaulich belegte. Aus Mangel an geeigneten Alternativen sah sich die Regierung zu Beginn der Pandemie gezwungen, eine absolut konsequente Null-Covid-Politik durchzusetzen. Das Maßnahmen-Paket enthielt Lockdowns in sämtlichen Größenordnungen: Von der einzelnen Wohneinheit, dem Wohnblock, dem Firmengelände über ganze Stadtviertel, Industriegebiete, Städte und Regionen.
Begleitet wurden diese Lockdowns häufig durch aufwändige Massentestungen, Beschränkungen des öffentlichen Lebens und der Mobilität inklusive umfangreicher Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Erkrankte Personen wurden größtenteils in staatlich überwachten Einrichtungen gesammelt und abgegrenzt. Internationale und nationale Reisebeschränkungen und strikte Quarantäneauflagen für Kontaktpersonen wurden in Kraft gesetzt. Viele Arbeitskräfte konnten aufgrund von Lockdowns oder für sie geltende Quarantäne-Bestimmungen zeitweise ihre Arbeit nicht antreten. Dies führte zu Problemen in der eigenen Wirtschaft (z.B. fehlende Waren in Supermärkten), aber auch zu deutlichen Engpässen in den internationalen Lieferketten. Aufgrund der Nachholeffekte nach der ersten Corona-Welle und den weltweiten fiskalischen und monetären Gegenmaßnahmen traf China erst in 2022 die deutliche Abkühlung der wirtschaftlichen Leistung.
Abkehr von der bisherigen Corona-Strategie sinnvoll
In vielen westlichen Ländern wurde mit breiten Impfkampagnen auf die Pandemie reagiert. Eine „kontrollierte Durchseuchung“ der immer besser geschützten Bevölkerung fand statt. Zum Vergleich: Laut offiziellen Statistiken hat China seit dem Jahr 2020 im Schnitt weniger als eine infizierte Person pro 1 Million Einwohner, auch wenn diese Zahl mittlerweile bei knapp über 20 liegt.
In den meisten Ländern wurden anfängliche Beschränkungen mittlerweile größtenteils wieder aufgehoben, die Wirtschaftsleistung ist nur noch in geringem Umfang durch fehlende Arbeitskräfte oder Betriebsschließungen aufgrund von Corona negativ beeinträchtigt. Impfstoffe sind in der Zwischenzeit global verfügbar, Produktionskapazitäten könnten sogar erweitert werden.
Auch Chinas Gesundheitssektor ist mittlerweile besser auf Corona eingestimmt, die Krankheit und mögliche Therapieformen sind besser erprobt und erforscht. Dies alles zeigte der chinesischen Führung, dass eine Abkehr von der Null-Covid-Politik mit geringerem Risiko als in der Vergangenheit möglich ist.
Lässt man die Pandemie-Jahre außer Acht, ist das chinesische Wirtschaftswachstum seit 2010 fast ausnahmslos leicht rückläufig, durchschnittlich um ~0,5% pro Jahr. Würde man nun ceteris paribus unterstellen, dies hätte sich ohne Corona fortgesetzt, wäre das Wachstum im Jahr 2022 bei rund 4,5% gelandet. Tatsächlich wird der jüngste Einbruch der chinesischen Wirtschaftsleistung zu einem Wachstum von geschätzten 3,3% auf Jahressicht führen. Grob abstrahiert haben die Corona-Maßnahmen also über 1% des Bruttoinlandsprodukts gekostet. Wir gehen davon aus, dass die tatsächlichen Kosten sogar deutlich darüber lagen.
Die Null-Covid-Politik ist demnach eine sehr kostspielige Angelegenheit, die sowohl den Wachstumspfad Chinas als auch die Mehrung des Wohlstands in China gefährdet. Laut einer von Goldman Sachs jüngst veröffentlichten Studie könnte eine vollständige Lockerung der Auflagen zu einem Anstieg des chinesischen Aktienmarktes von 20% führen und folglich eine Wertschöpfung von 2,6 Billionen US-Dollar mit sich bringen. So einfach könnte das Land seine wirtschaftliche Kraft neu entfalten und damit eines der obersten Ziele des chinesischen Staatspräsidenten und Chef der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, erfüllen. Eine Innenpolitik, in der das Wohlergehen des Einzelnen trotz hoher Kosten über das Wohl der Allgemeinheit gestellt wird, erscheint nüchtern betrachtet dauerhaft ohnehin nicht tragbar für China. Nachdem Xi Jinping, der zudem stark mit dem Kampf gegen Corona assoziiert wird, nun auf unbeschränkte Zeit wiedergewählt ist, scheint somit der Weg für einen Richtungswechsel frei – vielleicht sogar logisch – zu sein.
Die Anzeichen verdichten sich
Die Spekulationen um einen Kurswechsel in der Corona-Strategie der Regierung nahmen Ende Oktober an Fahrt auf, nachdem in sozialen Medien Bildmaterial von behördlichen Dokumenten mit ersten Hinweisen geteilt wurde. Dies wurde von Vertretern der Gesundheitsbehörde umgehend mehrfach dementiert. Am 10. November veröffentlichte die chinesische Regierung dennoch ein 20 Punkte umfassendes Maßnahmenpaket, vorgeblich, um die Corona-Kontrollmaßnahmen zu verbessern. In dem Maßnahmenpaket wurden einige Vorgaben gelockert, unter anderem die Quarantäne-Zeit nach Kontakt mit infizierten Personen und inländischen Reisen sowie damit einhergehende strenge Test-Auflagen.
Während die Auswirkungen dieses Pakets eher gering sind, setzt es doch ein starkes Zeichen und untermauert ein Umdenken der politischen Akteure. Nach einer Zuspitzung der großangelegten Massenproteste in Shanghai, Peking und anderen Metropolen am letzten Novemberwochenende gegen die strikten Corona-Maßnahmen und deren teils unmenschliche Durchsetzung, geriet die Regierung immer stärker unter Druck. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Sun Chunlan war Anfang Dezember bemüht, die Situation zu entschärfen und beschwor öffentlich „eine neue Phase und neue Aufgaben in der Seuchenbekämpfung aufgrund der erfolgreichen Impfkampagne, der gesammelten Erfahrungen und der geringeren Pathogenität der Omikron-Variante“. Im Anschluss wurde eine neue Impfkampagne für ältere Bevölkerungsgruppen ins Leben gerufen.
Der neue Umgang mit der Pandemie wird von Beobachtern seitdem als „Dynamische Null-Covid-Politik“ bezeichnet. Auch die chinesische Zentralbank unterstützt diesen Wortlaut mit angepasster Rhetorik, indem sie „den Fokus auf wirtschaftliches Wachstum nach einem Rückgang wirtschaftlicher Aktivität aufgrund von Corona-Maßnahmen“ setzt. So wurde der pragmatische Ansatz im Umgang mit Corona de facto durch ein Ausbleiben einer Erwähnung der „Null-Covid-Politik“ in der Erklärung, die der Sitzung des Politbüros vom 07.12.2022 folgte, eingeläutet. Der Immobiliensektor wurde interessanterweise nach der Sitzung der 24 Mitglieder ebenfalls nicht erwähnt. Für die Wirtschaft spielt der Immobiliensektor jedoch ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Probleme im Immobilienmarkt sollen aufgearbeitet werden
2020 ist in China eine gigantische Immobilienblase geplatzt, die viele große Immobilienentwickler des Landes wie Evergrande oder Fantasia Holdings im Anschluss in Schieflage brachte. Privates Wohneigentum existiert in China erst seit den Achtzigerjahren, die Nachfrage war seitdem entsprechend hoch. Jedoch wurde Wohnfläche nicht nur zur Eigennutzung erworben, sondern auch als Investitionsobjekt. Die Wohneinheiten unterlagen extremen Wertsteigerungen (vgl. Abb. 3).
Preissteigerung von Wohnimmobilien von 2011 bis 2021 (yuan/m²)
exemplarisch für die größten Städte des Landes
Die chinesische Regierung hat den Markt mit günstigen Rahmenbedingungen, einer laxen Regulierung und niedrigen Zinsen immer weiter befeuert. Dies führte zu einem stark aufgeblasenen Immobiliensektor, der allein im Jahr 2021 rund 6,5 Millionen Wohneinheiten fertigstellte. Zeitweise standen bis zu 90 Millionen Wohnungen im Land leer, Geisterstädte ohne Bewohner waren die Folge. Der Immobilien- und der Bausektor sind nach offiziellen Angaben zwar nur für 13,8% des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. Experten wie Kenneth Rogoff von der Harvard University gehen jedoch davon aus, dass – aufgrund der durch den Immobilienmarkt ausgelösten Wertschöpfung in anderen Industriesegmenten – das tatsächliche Gewicht in der Vergangenheit bei knapp 30% der gesamten Wirtschaftsleistung lag. Die Immobilienentwickler realisierten immer größere Bauprojekte mit irrwitzigen Volumina, finanziert durch hohe Summen an Fremdkapital.
In den vergangenen beiden Jahren adressierte Xi Jinping schließlich das stetig wachsende Systemrisiko durch ein Reformpaket. Die Regulierung wurde in mehreren Bereichen geschärft, die Fremdkapitalquoten limitiert. Aufgrund der hohen Summen gebundenen Kapitals in Bauprojekten und der fehlenden Fähigkeit der Refinanzierung strauchelten die Projektentwickler. Lange Zeit war die Regierung nicht bereit, die Firmen zu unterstützen und besiegelte somit die Zahlungsunfähigkeit von Immobilienentwicklern wie Evergrande. Die Botschaft der Regierung war angekommen: Risiken müssen schnellstmöglich reduziert werden.
Im November folgte ein Kurswechsel, um dem Krisensektor unter die Arme zu greifen: Ein Hilfspaket, bestehend aus Liquiditätsmaßnahmen und Kreditverlängerungen, ebnete den Weg. Zuletzt wurden große Banken angehalten, Kredite an Immobilienentwickler zu vergeben, damit diese ihre internationalen Schulden begleichen können, um weitere Zahlungsausfälle zu vermeiden und Ansteckungseffekte zu verhindern.
Von der Werkbank zum Weltmarkt
In der Vergangenheit wurde China zurecht als „Werkbank der Welt“ bezeichnet, da viele westliche Firmen ihre Fertigung in das Billiglohnland verlagert hatten. Bereits 2010 stieg China so zum weltgrößten Exporteur von Waren und Dienstleistungen auf. Trotz des niedrigen Pro-Kopf-Einkommens sicherte sich das Land bereits drei Jahre später den Titel als weltgrößte Handelsnation. Denn China importierte aufgrund des wachsenden Wohlstands seiner rund 1,4 Milliarden Bürger auch immer mehr Güter aus anderen Ländern.
Von der rigiden chinesischen Strategie, ausländische Unternehmen zu Kooperationen und Beteiligungen zu zwingen, profitierte die heimische Industrie in den vergangenen Jahrzenten enorm und steigerte zudem die Unabhängigkeit von westlichen Unternehmen. Initiativen wie die „Neue Seidenstraße“ und die weltweite Dominanz bei der Sicherung wichtiger Ressourcen zementierten den chinesischen Machtanspruch. China hat sich rasant von einem Industriepartner zu einer wirtschaftlichen Weltmacht entwickelt. Daher ist China längst nicht mehr nur mit Blick auf globale Lieferketten ausschlaggebend, auch der schier unersättliche Heimatmarkt ist von großer Bedeutung. Viele westliche Firmen bezeichnen China mittlerweile als ihren wichtigsten Absatzmarkt.
Außenpolitische Risiken
Aufgrund der zunehmenden globalen Dominanz Chinas ergeben sich mannigfaltige politische und geopolitische Risiken. Wie strikt die Regierung ihre Ziele verfolgt, zeigte unter anderem die zunehmende Einverleibung Hong Kongs, an der auch blutige Proteste der Bevölkerung und internationale Solidaritätsbekundungen nichts zu ändern vermochten. Die autonome chinesische Sonderverwaltungszone war lange Zeit durch das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ des ehemaligen Parteiführers Deng Xiaoping geschützt. Mit Blick auf die chinesische Republik Taiwan hängen Befürchtungen einer drohenden Annexion wie ein Damoklesschwert über den internationalen Beziehungen. Taiwan wurde von der Volksrepublik nie als eigenständiger Staat anerkannt. Die Maxime der Ein-China-Politik der Kommunistischen Partei besagt, dass Taiwan stets zu China gehört hat und wieder in die Volksrepublik eingegliedert werden muss. Nachdem im Jahr 2027 das 100-jährige Gründungsjubiläum der chinesischen Volksbefreiungsarmee bevorsteht, ist die Sorge einer Eskalation des schwelenden Konfliktes im Vorfeld groß. Der enge Verbündete USA wird nicht müde zu betonen, dass die Allianz mit Taiwan auch im Kriegsfall Bestand haben wird.
Auch die Beziehungen zu den USA selbst haben sich seit der Amtszeit Donald Trumps verändert. China wird von der amerikanischen Politik nun noch stärker als wirtschaftlicher und militärischer Konkurrent wahrgenommen. Eine zunehmende Demokratisierung, die oft mit der Öffnung einer Volkswirtschaft einhergeht, hat sich nicht eingestellt. Daher versuchen die USA seit geraumer Zeit, den Einfluss Chinas zu begrenzen, solange sie noch einen Vorsprung in entscheidenden Bereichen wie der Hochtechnologie innehaben. Nachdem bereits ein Handelskrieg mit gegenseitigen Strafzöllen zu deutlichen Verwerfungen führte, ist auch der Export sensibler Chip-Technologien sanktioniert worden. Aufgrund mangelnder Kompetenz in Schlüsseltechnologien ist China in essenziellen Bereichen stark eingeschränkt und muss in vielen Bereichen eine eigene Produktion etablieren, sofern möglich. Die enge Partnerschaft Chinas mit Nordkorea und Russland birgt zudem laufend Konfliktpotenzial, erschwert durch den fortwährenden Krieg in der Ukraine und den zunehmenden Provokationen Nordkoreas mit seinem Atomwaffen- und Trägerraketenprogramm.
Fazit
In der neuen Amtszeit Xi Jinpings wird sich die Regierung vor allem auf die Stärkung des chinesischen Wirtschaftswachstums fokussieren. Wir gehen davon aus, dass der strauchelnde Immobilienmarkt vor einem Kollaps bewahrt und die Wirtschaft schrittweise durch eine Lockerung der Null-Covid-Politik geöffnet wird. Für Investoren bietet der chinesische Finanzmarkt deshalb vielfältige Chancen, allerdings immer mit scharfem Blick auf die damit verbundenen Risiken. Nachdem der westliche Protektionismus während der Pandemie in den Hintergrund rückte, könnten neuerliche Handelsdifferenzen Realität werden.
Unsere China-Strategie konzentriert sich daher auf zwei Arten von Unternehmenstypen: Einerseits sind das Unternehmen, die langfristige internationale Trends bedienen und hierbei eine dominante Rolle einnehmen. Im Fokus stehen beispielsweise Unternehmen, deren Produkte für die Energiewende unverzichtbar sind. Auf der anderen Seite favorisieren wir aber auch Unternehmen, die einen hohen Anteil ihrer Umsätze durch Binnennachfrage erzielen und zudem einen entscheidenden Stellenwert im wirtschaftlichen Ökosystem Chinas innehaben. Diese Unternehmen finden sich in vielen Branchen und sind beispielsweise Plattformanbieter für digitale Dienstleistungen, Waren oder Mobilität.
Aufgrund abnehmender internationaler Kooperation mit dem Westen und zunehmender Konflikte – politisch wie geopolitisch – sollten Investitionen in China immer wohldosiert bleiben, sind aber hinsichtlich der Wachstumsaussichten attraktiv und zur Diversifikation des Portfolios unabkömmlich.